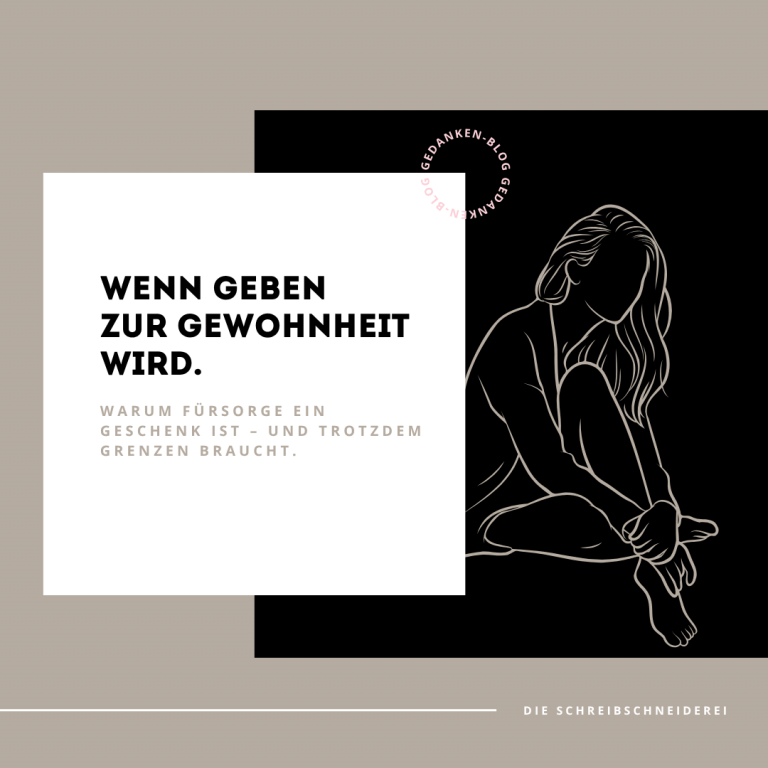
Wir geben, weil wir lieben.
Weil wir helfen wollen.
Weil wir es können.
Und irgendwann geben wir, weil wir es gewohnt sind.
Weil niemand mehr fragt, ob wir überhaupt noch können.
Oder wollen.
Die stille Rolle der Starken.
Und das leise Leiden dahinter.
Es sind selten die Lauten, die am meisten geben.
Es sind die, die man nicht darum bitten muss.
Die, die funktionieren.
Die, die sich (immer) kümmern.
Die, die alles am Laufen halten – selbst, wenn sie innerlich längst auf Reserve laufen.
Sie sind verlässlich.
Belastbar.
Und müde.
So müde.
Denn Geben ist schön.
Aber ständiges Geben ist anstrengend.
Vor allem, wenn man sich selbst dabei vergisst.
Wenn Fürsorge kippt.
Fürsorge ist Liebe in Aktion.
Aber wenn sie zur Gewohnheit wird, verliert sie ihre Freiwilligkeit.
Dann wird aus einer Geste ein Reflex.
Aus einem „Ich will helfen“ wird ein „Ich muss“.
Und plötzlich bemerken wir, dass wir ständig das Gleichgewicht halten zwischen Geben und Aufbrauchen.
Nicht, weil jemand uns ausnutzt – sondern weil wir selbst nicht stoppen können.
Das gute Gefühl, gebraucht zu werden.
Geben fühlt sich gut an.
Es schenkt Sinn.
Es vermittelt Nähe.
Es stillt das leise Bedürfnis, wichtig zu sein.
Aber genau da liegt die Falle. Denn wer immer gebraucht werden will, braucht selbst kaum noch etwas.
Zumindest nach außen.
Nach innen hingegen? Da wächst eine Erschöpfung, die wir gut kaschieren.
Wir lächeln, wenn wir eigentlich leer sind. Wir sagen „kein Problem“, obwohl es längst eins ist.
Und irgendwann wissen wir gar nicht mehr, wie man nimmt – ohne sich schuldig zu fühlen.
Die Angst, zu viel zu sein.
Die, die viel geben, haben Angst, Grenzen zu setzen.
Nicht, weil sie schwach sind, sondern weil sie befürchten, weniger gemocht zu werden. Oder als egoistisch zu gelten.
Aber Selbstfürsorge ist kein Egoismus.
Sie ist die Grundlage dafür, dass Geben überhaupt möglich bleibt.
Denn wer immer nur austeilt, verliert irgendwann das Gefühl für das eigene Maß.
Und ohne Maß wird auch Liebe oder Freundschaft zu Last.
Kleine Warnsignale.
Was dein Körper längst weiß, dein Kopf aber ignoriert.
✦ Du bist erschöpft, aber sagst trotzdem Ja.
✦ Du kümmerst dich, obwohl du keine Kraft hast.
✦ Du hörst zu, obwohl du selbst reden müsstest.
✦ Du entschuldigst dich, wenn du mal Nein sagst.
Das sind keine Gesten von Stärke.
Das sind Signale von Überforderung.
Und sie sind leise.
So leise, dass man sie fast übersieht. Vor allem, wenn man immer die ist, die alles schafft.
Geben darf leicht sein.
Geben verliert seine Schönheit nicht, wenn man Grenzen zieht.
Im Gegenteil.
Erst dann wird es wieder echt.
Weil es nicht aus Pflicht kommt, sondern aus Gefühl.
Nicht aus Gewohnheit, sondern aus Freiwilligkeit.
Es ist kein Zeichen von Schwäche, weniger zu geben.
Es ist ein Zeichen von Bewusstsein.
Denn wer sich selbst achtet, gibt anders. Weniger oft vielleicht. Aber mit mehr Herz.
Wenn Geben wieder leicht werden darf.
Bewusste Fürsorge beginnt da, wo wir uns selbst zuhören.
Wo wir innehalten, bevor wir reflexhaft helfen.
Wo wir uns fragen: „Mache ich das gerade aus Liebe? Oder aus Gewohnheit?“
Manchmal reicht es, kleine Dinge zu verändern.
Ein ehrliches Nein. Eine Pause, bevor man wieder einspringt. Ein Moment des Nachspürens, ob es gerade wirklich das Richtige ist.
Selbstfürsorge bedeutet nicht, niemandem mehr etwas zu geben.
Sie bedeutet, das Geben wieder zu wählen – statt es einfach nur zu tun.
Wenn Geben wieder eine Entscheidung wird, bekommt es seine Schönheit zurück.
Dann fühlt sich Fürsorge nicht mehr wie ein Zwang an, sondern wie ein Geschenk.
Ein Geschenk, das du dir selbst machen darfst.
Fürsorge braucht Bewusstsein.
Man kann sich in Fürsorge verlieren.
Aber man kann sich auch in ihr wiederfinden – wenn man lernt, sie dosiert zu leben.
Denn das Schönste am Geben ist nicht, dass andere dich brauchen.
Sondern dass du es tust, weil du willst.
Und nicht, weil du musst. ♥️
Folge mir.
Wenn du mehr solcher Gedanken
lesen möchtest oder einfach Lust
hast, dich auszutauschen:
Auf meinem Instagram-Profil
nehme ich dich mit:
Schonungslos ehrlich.
Manchmal unbequem.
Aber immer echt.
Nachbemerkung.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Blogartikel die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Lust auf mehr Gedanken? Gibt’s hier.
